Hartnäckig an den eigenen Fragen zu bleiben und doch offen für die Risse: Das ist Kabelo Malatsies Position für die Arbeit als Kuratorin der Kunsthalle. Einstimmigkeit und gegenseitiges Sich-Beklatschen bedeuten ihr dabei wenig.
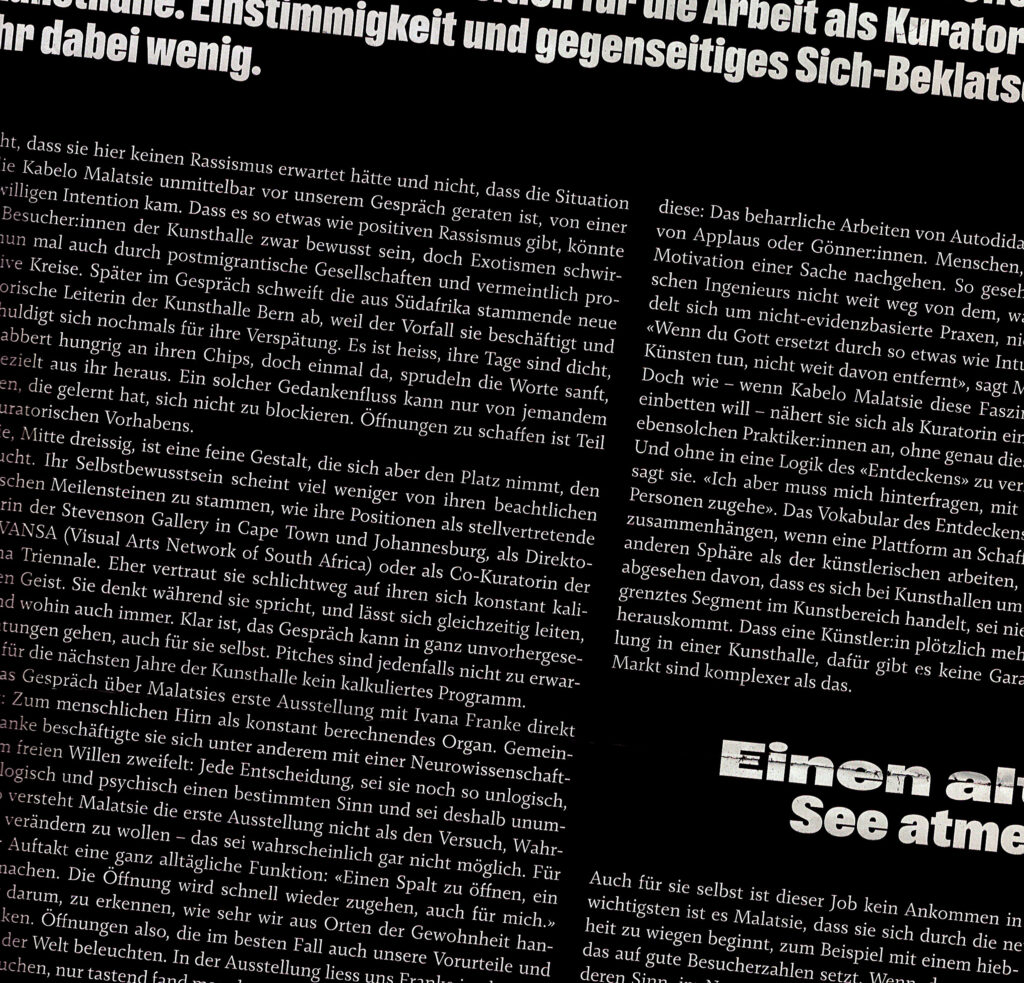
Nicht, dass sie hier keinen Rassismus erwartet hätte und nicht, dass die Situation in die Kabelo Malatsie unmittelbar vor unserem Gespräch geraten ist, von einer böswilligen Intention kam. Dass es so etwas wie positiven Rassismus gibt, könnte den Besucher:innen der Kunsthalle zwar bewusst sein, doch Exotismen schwirren nun mal auch durch postmigrantische Gesellschaften und vermeintlich progressive Kreise. Später im Gespräch schweift die aus Südafrika stammende neue kuratorische Leiterin der Kunsthalle Bern ab, weil der Vorfall sie beschäftigt und entschuldigt sich nochmals für ihre Verspätung. Es ist heiss, ihre Tage sind dicht, sie knabbert hungrig an ihren Chips, doch einmal da, sprudeln die Worte sanft, aber gezielt aus ihr heraus. Ein solcher Gedankenfluss kann nur von jemandem kommen, die gelernt hat, sich nicht zu blockieren. Öffnungen zu schaffen ist Teil ihres kuratorischen Vorhabens.
Malatsie, Mitte dreissig, ist eine feine Gestalt, die sich aber den Platz nimmt, den sie braucht. Ihr Selbstbewusstsein scheint viel weniger von ihren beachtlichen biografischen Meilensteinen zu stammen, wie ihre Positionen als stellvertretende Direktiorin der Stevenson Gallery in Cape Town und Johannesburg, als Direktorin von VANSA (Visual Arts Network of South Africa) oder als Co-Kuratorin der Yokohama Triennale. Eher vertraut sie schlichtweg auf ihren sich konstant kalibrierenden Geist. Sie denkt während sie spricht, und lässt sich gleichzeitig leiten, wovon und wohin auch immer. Klar ist, das Gespräch kann in ganz unvorhergesehene Richtungen gehen, auch für sie selbst. Pitches sind jedenfalls nicht zu erwarten – und für die nächsten Jahre der Kunsthalle kein kalkuliertes Programm.
Obwohl das Gespräch über Malatsies erste Ausstellung mit Ivana Franke direkt dahinführt: Zum menschlichen Hirn als konstant berechnendes Organ. Gemeinsam mit Franke beschäftigte sie sich unter anderem mit einer Neurowissenschaftlerin, die am freien Willen zweifelt: Jede Entscheidung, sei sie noch so unlogisch, habe neurologisch und psychisch einen bestimmten Sinn und sei deshalb unumgänglich. So versteht Malatsie die erste Ausstellung nicht als den Versuch, Wahrnehmungen verändern zu wollen – das sei wahrscheinlich gar nicht möglich. Für sie hatte der Auftakt eine ganz alltägliche Funktion: «Einen Spalt zu öffnen, ein wenig Luft machen. Die Öffnung wird schnell wieder zugehen, auch für mich.» Es gehe eher darum, zu erkennen, wie sehr wir aus Orten der Gewohnheit handeln und denken. Öffnungen also, die im besten Fall auch unsere Vorurteile und Positionen in der Welt beleuchten. In der Ausstellung liess uns Franke in absolute Dunkelheit tauchen, nur tastend fand man den Weg, um erst nach langen Minuten fragile Objekte zu erkennen. Sie bewegen und verändern sich durch Standpunkt und Blick der Betrachtenden. Man ist Malatsie und Franke dankbar für die Zeit, die sie uns zwingen zu nehmen, um überhaupt in diese verunsichernde, aber visuell magische Sphäre eintreten zu dürfen.
Wissenschaft jenseits der Wissenschaft
Orte der Gewohnheiten können für Malatsie wiederum genau diese sein: Sich den Wissenschaften als einzige Konstante in einer unstabilen Welt anzuvertrauen. Durch ihre Herkunft habe sie ein offeneres Verständnis gegenüber Wissenschaft und Technologie jenseits der monolithischen westlichen Forschung. «Es ist eine Frage des Vertrauens und in diesem Sinne hat mich die Geschichte gelehrt, dem Westen nicht zu vertrauen.» Wenn Wissenschaft in einem sehr viel weiteren Begriff verstanden wird, habe sie durchaus in ihrer kuratorischen Praxis damit zu tun. Sie nennt das: verkörperlichte Wissensproduktion.
Malatsie gibt als Beispiel die Arbeiten von Stephen Alexander an, einem Physiker und Kosmologisten, der John Coltranes Improvisationen als Studien des Kosmos versteht. Solche Wissenschaft sei für sie produktiv, da es die Arbeit von praxisorientierter Arbeit validiert. Als weiteres Beispiel nennt sie den autodidaktischen Ingeneur Sangulani Chikumbutso aus Simbabwe, der angeblich in 20-jähriger Eigenregie Fahrzeuge und Fernseher entwickelt hat, die weder Elektrizität noch Treibstoff benötigen. Seiner Überzeugung zufolge, habe der christliche Gott ihm die Formeln gegeben. Auch wenn seine Erfindungen auf Fiktionen beruhen, zumindest hinsichtlich der religiösen Ursprünge der Formeln, und es auch eine Nähe gibt zur Verschwörungstheorie, interessiert sich Malatsie für Phänomene wie diese: Das beharrliche Arbeiten von Autodidakt:innen an ihrer Sache, ohne Chöre von Applaus oder Gönner:innen. Menschen, die mit nichts ausser intrinsischer Motivation einer Sache nachgehen. So gesehen sei die Praxis dieses simbabwischen Ingenieurs nicht weit weg von dem, was Künstler:innen machen: Es handelt sich um nicht-evidenzbasierte Praxen, nicht abgesichert durch Peerreviews. «Wenn du Gott ersetzt durch so etwas wie Intuition, dann ist das, was wir in den Künsten tun, nicht weit davon entfernt», sagt Malatsie.
Doch wie – wenn Kabelo Malatsie diese Faszination in ihre kuratorische Praxis einbetten will – nähert sie sich als Kuratorin einer mittelgrossen Kunstinstitution ebensolchen Praktiker:innen an, ohne genau diese Eigenständigkeit zu gefährden? Und ohne in eine Logik des «Entdeckens» zu verfallen? «Sie brauchen dich nicht», sagt sie. «Ich aber muss mich hinterfragen, mit welcher Intention ich auf solche Personen zugehe». Das Vokabular des Entdeckens und die Erwartungen, die damit zusammenhängen, wenn eine Plattform an Schaffende vergeben wird, die in einer anderen Sphäre als der künstlerischen arbeiten, findet sie problematisch. Denn abgesehen davon, dass es sich bei Kunsthallen um ein sehr spezifisches und eingegrenztes Segment im Kunstbereich handelt, sei nie klar, was auf der anderen Seite herauskommt. Dass eine Künstler:in plötzlich mehr Erfolg hat nach ihrer Ausstellung in einer Kunsthalle, dafür gibt es keine Garantie. Die Dynamiken auf dem Markt sind komplexer als das.
Einen alten See atmen
Auch für sie selbst ist dieser Job kein Ankommen in einem sicheren Hafen. Am wichtigsten ist es Malatsie, dass sie sich durch die neue Position nicht in Sicherheit zu wiegen beginnt, zum Beispiel mit einem hieb- und stichfesten Programm, das auf gute Besucherzahlen setzt. Wenn, dann sucht sie Sicherheit in einem anderen Sinn, im Netz eigener Interessen. Ihre singuläre Neugier ist ihr Programm. Denn Einstimmigkeit und sich gegenseitig beklatschen, das bedeutet ihr wenig: «Ich hoffe in Zukunft Ausstellungen zu machen, die gute Fragen stellen. Und dass wir die Moral, die im Wort «gut» versteckt ist, diskutieren können. Auch unter Kurator:innen gibt es keinen Konsens zur Frage, was genau interessant ist. Ich will bei meinen Fragen bleiben, sie aber teilen mit anderen.»
Eine dieser Fragen ist das kollaborative Kuratieren. «7 Winds» ist ein Rechercheprojekt, das sie mit Julia Küenzi und Camilla Paolino initiert hat, inspiriert von einer Geschichte über die sieben Namen für Wind, wie sie im Senslerdeutsch, einem Dialekt im deutschen Teil des Kantons Fribourg, vorkommen. Umgangsprachen können Konzepte beinhalten, die verloren gehen mit den Sprachen selbst, und das Rechercheprojekt benutzt diese Geschichte um über Sprache aus verschiedenen Perspektiven nachzudenken, über Fehlübersetzungen oder Unübersetzbarkeit und verkörperlichte Sprache. In dieser Recherche wollen die beteiligten Kuratorinnen herausfinden, welche Ansprüche man beim kollaborativen Kuratieren stellen kann: Wie weit kann man den kollaborativen Anspruch treiben? Muss das harmonisch sein oder kann es auch zur Kakophonie kommen? Was bedeutet diese Form des Kuratierens für eine mittelgrosse Kulturinstition?
Liest man über Kabelo Malatsie in ihrer neuen Position an der Berner Kunsthalle, taucht Wind als Begriff immer wieder auf. Seit einigen Jahren interessiert sich Malatsie für Staubstürme aus der Sahara, sie stehen für sie für einen Paradigmenwechsel in ihrer eigenen Praxis. Der Staub kommt von einem vorzeitlichen See, der vor Jahrtausenden ausgetrocknet ist. Er wird jedes Jahr vom Wind aufgelesen und in alle Richtungen getragen, auch in die Schweiz, wo er den Himmel färbt und die Autos beschmutzt. «Der Staub spricht für mich über so etwas wie Vermischung von Terrain und gibt uns die Möglichkeit, über Internationalität in einem viel weiteren zeitlichen Rahmen als sonst zu denken. Ein uralter See vermischt sich buchstäblich mit unserem Atem von 2022.» Staub und Wind sind produktive Rahmungen, die ihr helfen, aus einer Mensch-zentrierten Perspektive zu treten. Wenn Kabelo Malatsie eines verkörpert, dann, dass «bei sich zu bleiben» insbesondere sich re-platzieren zu lassen bedeutet. Wovon und wohin, das hat man dann wohl doch den kleinen Rissen in einem weitgehend determinierten Leben zu verdanken.
Dieser Text erschien zuerst in der gedruckten Septemberausgabe des KSB Kulturmagazins.
